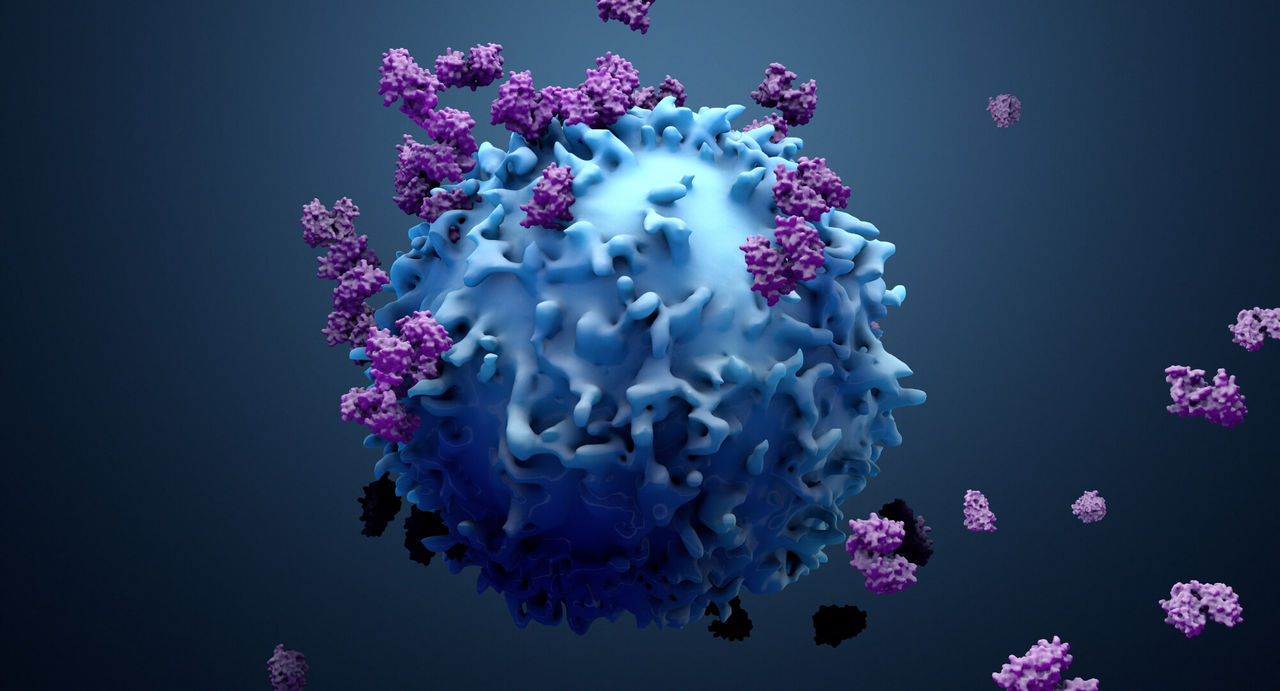Innerhalb der Menarini-Gruppe ist Berlin-Chemie die regionale Zentrale für die Region MOE und GUS und zuständig für mehr als 30 Länder und deren lokale Tochtergesellschaften.
Als zuverlässiger Partner im Gesundheitswesen wollen wir mit unseren Produkten und unserem Know-how dazu beitragen, die komplexen Herausforderungen im Gesundheitswesen in diesen Regionen zu lösen. Zu diesem Zweck hat Berlin-Chemie in vielen Ländern starke Partnerschaften auf allen Ebenen aufgebaut. Wir unterstützen Ärzte und Patienten mit hochwertigen medizinischen Produkten und Technologien, um die Lebensqualität zu verbessern.